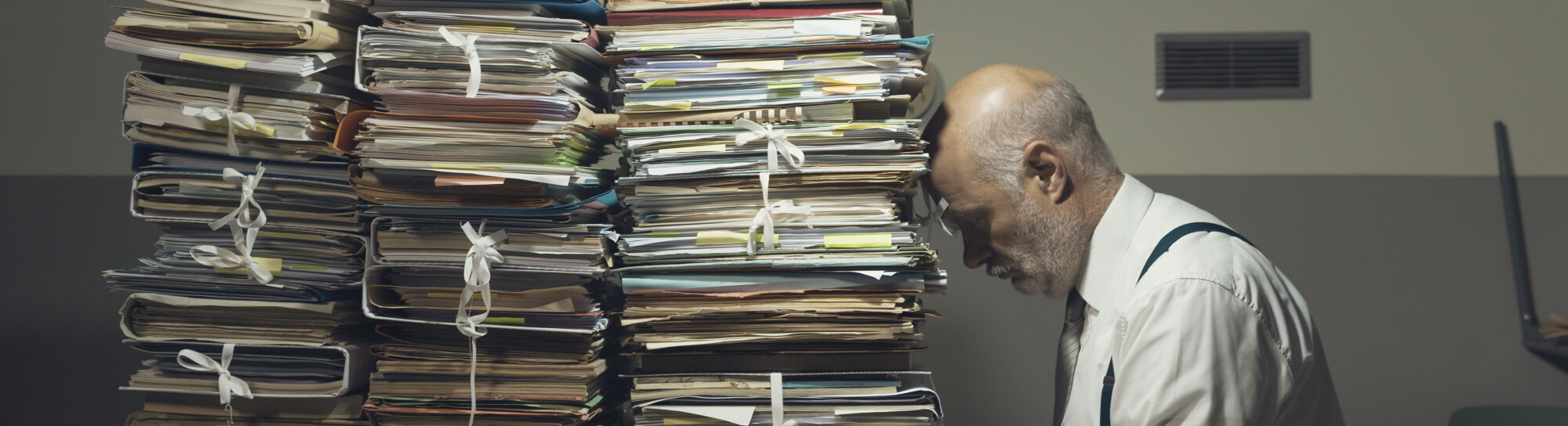
Landwirtschaft geht nicht vom Bürostuhl aus
Die vielen neuen Vorschriften stellen die Landwirte vor schier unlösbare Aufgaben. Wie so häufig verunmöglicht die gut gemeinte Regulation alltagstaugliche Lösungen für eine ressourceneffiziente Produktion. Drei Experten äussern sich in den bäuerlichen Medien kritisch und halten die lange Liste geplanter Massnahmen für praxisfern. Es fragt sich, was geschieht, wenn es den Landwirten dereinst «verleidet», ihren Beruf auszuüben.
Donnerstag, 25. November 2021
Seit vielen Jahren forscht Dr. Andreas Keiser, Dozent für Ackerbau und
Pflanzenzüchtung an der Hochschule für Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften HAFL in Zollikofen, mit seiner Arbeitsgruppe am
Ziel, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Ackerbau deutlich zu reduzieren,
ohne die Ertragssicherheit und Qualität zu gefährden. Die geplanten
agrarpolitischen Reformen im Ackerbau beurteilt er kritisch gegenüber der
Zeitschrift «Die Grüne»: «Moderne Technologien, die Ressourceneffizienz oder
auch die integrierte Produktion würden ausser Acht gelassen.»
Hohe Administrationskosten
Auch Sepp Sennhauser, Co-Präsident von Bio Ostschweiz und St. Galler Mitte-Kantonsrat, ist unzufrieden mit der langen Liste neuer Vorschriften für die Landwirtschaft: «Schleppschlauch-Obligatorium, Absenkpfad für Pestizide und Nährstoffe, Eiweissprogramm statt GMF, Programm alte Kühe, 3,5 Prozent Biodiversitätsfläche auf Ackerflächen, Massentierhaltungs-Initiative, Gegenvorschlag dazu usw. Da werden Programme erschaffen, die vielleicht ein hehres Ziel haben, aber meilenweit entfernt sind von der Praxis.» Er ist sich sicher, die Vorschriften würden vor allem zusätzliche Amts- und Kontrollstellen mit den dazugehörenden Auflagen und Kosten verursachen.
Fehlende Personalressourcen
Für viele Betriebe sind all diese administrativen Auflagen nicht zumutbar.
Es fehlt den Bauernbetrieben an Personalressourcen. Gemäss Lohnunternehmer
Martin Herzig wird der Pflanzenschutz zur vollamtlichen Profiaufgabe. Gegenüber
der «Bauernzeitung» sagt Herzig: «Es fehlt vielen Ämtern an Praxisbezug.» Man
müsse den «Bitz spüren» und nicht den Bürostuhl, wolle man sinnvolle Gesetze
erlassen. Landwirtschaft vom Bürotisch aus zu betreiben, sei jetzt und auch in
Zukunft nicht möglich. Etwas konsterniert meint Herzig: «Immer wieder spricht
man davon, dass es im Bereich der Bürokratie einfacher wird, aber es passiert
genau das Gegenteil.»
Mehr Import
Die Bürokratisierung der Landwirtschaft treibt viele Landwirte aus dem
Beruf. Die Experten sind sich einig: Sie wollen in der Schweiz Lebensmittel
produzieren. Die Schweiz hat gute Produktionsvoraussetzungen und auch eine
Verpflichtung, einen angemessenen Teil der Lebensmittel hier zu produzieren.
Doch wenn die produktive Landwirtschaft durch Vorschriften und Bürokratie immer
mehr ausgebremst wird, verlagern sich die Emissionen ins Ausland und der Import
an Lebensmitteln nimmt unweigerlich zu. Umwelt und Klima ist damit nicht
geholfen.
Landwirtschaftsberuf attraktiv halten
Die Herausforderung, Bauern in der Landwirtschaft zu halten und Junge für
den Landwirtschaftsberuf zu begeistern, ist überall auf der Welt ein grosses
Thema. Denn gemäss UNO-Prognosen steigt die Weltbevölkerung bis 2050 auf 10
Milliarden Menschen an, wovon 70 Prozent in Städten leben werden. Vereinfacht
gesagt, müssen die 30 Prozent auf dem Land lebende Weltbevölkerung den Rest
ernähren. Technologische Unterstützung fördert nicht nur die Attraktivität des
Berufes, sondern ermöglicht auch, dass ältere und körperlich nicht so kräftige
Menschen den Beruf ausüben können. Dies ist umso wichtiger in Ländern, in denen
die landwirtschaftliche Erwerbsbevölkerung altert. Hier könnte die Anpassung
der landwirtschaftlichen Technologien und der Agrarpolitik an die Fähigkeiten
und Bedürfnisse älterer Landwirte dazu beitragen, dass ältere Menschen
weiterhin produktiv tätig sind.
Blindspot-Artikel
Sources
FAO: The Future of Food and Agriculture. Trends and challenges.
Die Grüne, Nr. 10 (nur Print)
Ähnliche Artikel

Warum strenge Gentech-Regulierung Innovation bremst
Neue Züchtungsmethoden wie Crispr-Cas gelten als Schlüssel für resistente Pflanzen, stabile Erträge und weniger Pflanzenschutz. ETH-Professor Bruno Studer warnt: Wer diese Technologien überreguliert, stärkt ausgerechnet jene grossen Agrarfirmen, die man eigentlich bremsen will – und schliesst kleinere Züchter und Start-ups vom Markt aus.

Superfood mit Ecken und Kanten
Die Süsslupine ist Biovisions «Superfood des Jahres 2026». Sie liefert viel Protein, verbessert Böden und fördert die Biodiversität. Doch der Blick auf die Praxis zeigt: Ohne Züchtung, Pflanzenschutz und Innovation bleibt auch dieses Superfood eine Herausforderung.

Verkaufsstopps wegen PFAS: Müssen wir uns Sorgen machen?
Nach spektakulären Verkaufsverboten für Fisch und Fleisch wegen PFAS-Belastungen stellen sich Konsumentinnen und Konsumenten die Frage: Wie gefährlich sind die Stoffe wirklich – und was landet noch bedenkenlos im Einkaufschörbli?

Wie deutsche Experten über neue Züchtungsmethoden denken
In kaum einem anderen Land wird die Bio-Landbau-Idylle in der Öffentlichkeit so gepflegt wie in Deutschland. Natürlichkeit und ländliche Ursprünglichkeit sind mentale Sehnsuchtsorte vieler Deutscher. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass der Widerstand gegen neue Züchtungsmethoden gross ist – und dass die Unkenntnis über den eigenen Bio-Landbau fast schon vorsätzlich wirkt.

