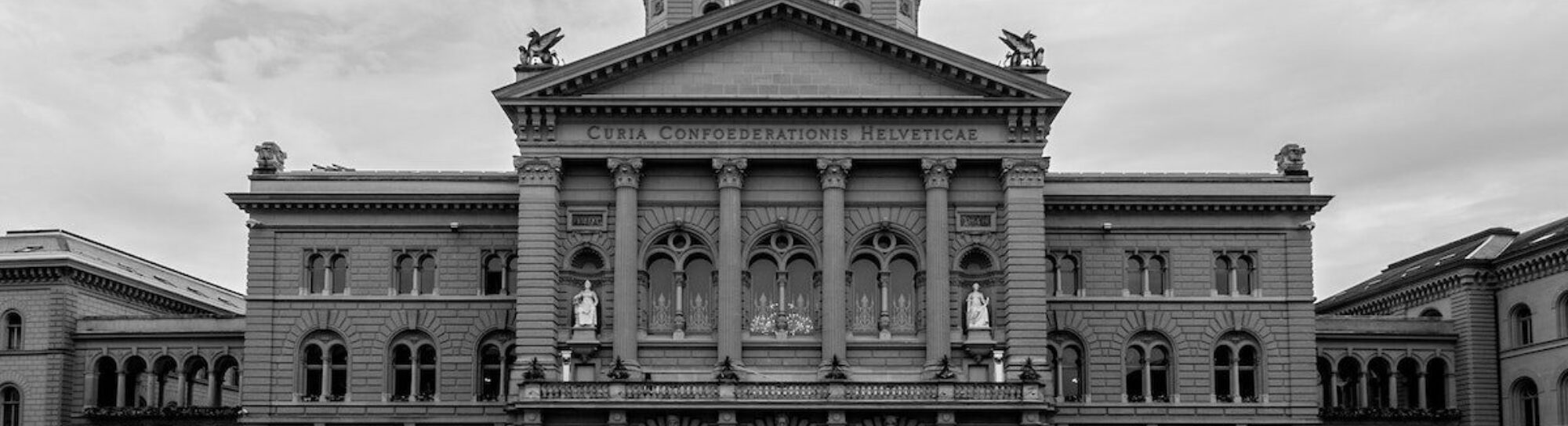
Prüfbericht stellt Pestizid-Verbot infrage
Am 12. Dezember kündigte der Bund das Verbot des Fungizids Chlorothalonil an – obwohl ein Prüfbericht zwei Abbauprodukte als «nicht relevant» einstufte.
Freitag, 21. Februar 2020
Das Wichtigste in Kürze:
- Ende 2019 hat der Bund das Fungizid Chlorothalonil verboten.
- Dies obwohl ein Prüfbericht des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die umstrittenen Abbauprodukte als "nicht relevant" einstufte.
- Der Bund erliess das Verbot entgegen den Befunden der eigenen Behörde. Syngenta hat deshalb beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen das Verbot eingelegt.
Dieser Artikel von Stefan Häne erschien als Erstveröffentlichung am 20. Februar 2020 im Tages-Anzeiger.
Die Schweiz hat mit der EU gleichgezogen. Auf Anfang Jahr hat der Bund Chlorothalonil verboten. Doch der Streit über das Fungizid, das seit den 70er-Jahren vor allem im Ackerbau zur Anwendung gelangt, dreht weiter – nicht nur, weil sich viele fragen, ob das Trinkwasser noch bedenkenlos geniessbar ist (was laut Behörden der Fall ist).
Welche Kreise der Fall inzwischen zieht, zeigt ein Schreiben, das Syngenta den Bundesbehörden geschickt hat. Der Basler Agrochemiekonzern, der Chlorothalonil herstellt, kritisiert darin namentlich die «Kommunikation» des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) scharf. Das Amt schaffe bei Trinkwasserversorgern und in der Bevölkerung «Unsicherheiten», «ohne dass hierfür Grund besteht», heisst es im Brief, der vom 4. Februar datiert und uns vorliegt. Unterzeichnet haben ihn Roman Mazzotta, Länderpräsident Syngenta Schweiz, und Geschäftsführer Stefan Odermatt.
Schweiz folgte der EU
Umstritten ist, ob das verhängte Verbot das Resultat sauberer Risikoanalysen ist – oder politisch motiviert. Kantonschemiker hatten im vergangenen Jahr rund 300 Trinkwasserproben erhoben, verteilt über die gesamte Schweiz und Liechtenstein. Bei insgesamt zwölf davon stellten sie Konzentrationen über dem gesetzlich zulässigen Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter fest, bei der Mehrheit handelte es sich um Chlorothalonil-Sulfonsäure, ein Abbauprodukt von Chlorothalonil mit der Bezeichnung R417888.
Untersuchungen des ETH-Wasserforschungsinstituts förderten zudem ein weiteres Abbauprodukt zutage, das im Grundwasser in Konzentrationen bis zu 2,7 Mikrogramm pro Liter vorkam: den Stoff mit der Bezeichnung R471811.
Es waren nicht zuletzt diese Funde, welche die Kontroverse um den Pestizideinsatz in der Schweiz weiter befeuerten. Parlamentarier reichten Vorstösse ein, der federführende SP-Bundesrat Alain Berset sprach von einer Politik der «Nulltoleranz».
Zuvor schon war der Druck auf den Bund, das Fungizid vom Markt zu nehmen, gewachsen: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit war zum Schluss gelangt, für Abbauprodukte von Chlorothalonil könne eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Die EU-Kommission verhängte daraufhin im Frühjahr 2019 ein Verbot für das Fungizid.
Keine Höchstwerte verletzt
Bersets Experten im BLV teilen die Einschätzung der EU-Kommission, dass Chlorothalonil «als wahrscheinlich krebserregend eingestuft werden muss». So stand es in jener Mitteilung vom 12. Dezember 2019, in der die Bundesbehörden das Verbot für das Fungizid ankündigen – einen halben Monat vor dessen Inkraftsetzung.
Indes: Die beiden erwähnten Abbauprodukte werden als «nicht relevant» eingestuft – nicht nur von Syngenta, sondern auch vom BLV selber. Das belegt ein Prüfbericht des Bundesamts vom 3. Dezember 2019. Diese Tatsache war Bersets Experten also schon bekannt, als die Bundesbehörden am 12. Dezember das Verbot ankündigten.
Die Klassifizierung als «nicht relevant» hat zur Folge, dass für diese Abbauprodukte ein markant höherer Höchstwert gilt: 10 Mikrogramm pro Liter statt bloss 0,1 wie bei «relevanten» Stoffen. Entsprechend seien an allen Messstandorten keine Höchstwerte verletzt worden, rechnet Syngenta vor. Das BLV dementiert diese Aussage nicht.
Syngenta wirft dem BLV daher vor, widersprüchlich zu handeln – eine Kritik, die das Amt zurückweist: Chlorothalonil habe Nierentumore bei Ratten und Mäusen verursacht, schreibt das BLV auf Anfrage. Daher sieht das Amt die Voraussetzung für eine Einstufung als «wahrscheinlich krebserregend» erfüllt.
Automatisch «relevant» sind laut BLV deshalb auch alle Abbauprodukte (sogenannte Metaboliten), die über dem Grenzwert von 0,1 Mikrogramm gemessen wurden – «ungeachtet von Studien zu Metaboliten, welche einen krebserzeugenden Effekt dementieren». «Dadurch wird sichergestellt, dass die Konsumenten in der Schweiz nicht mit Pestiziden mit besorgniserregenden toxikologischen Eigenschaften in Kontakt kommen.»
Noch nicht strenger eingestuft
Diesen Automatismus bestreitet Syngenta. Der Chemiekonzern hält das Verbot für «unverhältnismässig und willkürlich»: Selbst wenn ein Wirkstoff wie Chlorothalonil strenger klassifiziert werde, sei ein Metabolit nicht zwingend relevant. Syngenta verlangt vom BLV, die gesetzliche Grundlage für das Vorgehen zu nennen. Das BLV verweist auf Anfrage dieser Zeitung auf die Pflanzenschutzmittelverordnung. Demnach werden die «technischen Dokumente und Leitlinien», die in der EU verabschiedet werden, bei der Beurteilung von Pestiziden berücksichtigt.
Bedeutsam vor diesem Hintergrund ist, dass Chlorothalonil in der EU nach wie vor in der Kategorie 2 eingestuft ist. Das heisst: Es steht «nur» im Verdacht, möglicherweise krebserregend zu sein, es ist also nicht «wahrscheinlich krebserregend» (Kategorie 1B), wie dies die EU-Kommission sagt. Der Unterschied rührt daher, dass die EU-Kommission die Einschätzung der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit übernommen hat.
Für die Klassifizierung zuständig ist aber die Europäische Chemikalienagentur. Doch diese Fachstelle hat das Fungizid offenbar bis heute nicht neu beurteilt. Das BLV meint dazu: «Die Sicherheit der Konsumenten in der Schweiz soll nicht von einem administrativen Prozess in der EU abhängen.» Daher habe das BLV umgehend reagiert.
Prüfbericht lange unveröffentlicht
Weniger eilig hatte es das Amt, den neuen Prüfbericht vom 3. Dezember zu veröffentlichen. Erst am vergangenen Freitag schaltete ihn das BLV auf seiner Website auf. Zeit lässt es sich auch, auf das Schreiben von Syngenta zu reagieren. Der Konzern, vom Verbotsbeschluss des Bundes «in hohem Masse betroffen», verlangt darin eine Antwort bis am 10. Februar.
Die Frist ist längst verstrichen. Das BLV verteidigt sich: «Wir sind bestrebt, alle unsere Kunden gleich zu behandeln und innerhalb von zwei Wochen eine Antwort zu geben.» Dies werde auch bei Syngenta der Fall sein.
Die Streitpunkte kommen spätestens vor Gericht wieder aufs Tapet. Syngenta hat beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen das Verbot eingelegt. Es geht nicht zuletzt um viel Geld. Bis ein neuer Wirkstoff auf dem Markt ist, vergehen rund zehn Jahre. Die Kosten belaufen sich laut Syngenta jeweils auf rund 260 Millionen Franken. Verlässliche Rahmenbedingungen für den Forschungsplatz Schweiz, so Sprecherin Regina Ammann, seien daher zentral.
Fakten zum Chlorothalonil-Verbot in der Schweiz
Ein Faktenblatt zum Verbot des Fungizids Chlorothalonil und zu den Hintergründen des Rechtsstreits kann auf der Webseite von Syngenta gefunden werden.
Fakten zum Chlorothalonil-Verbot in der Schweiz (PDF, 147.93 KB)
Ähnliche Artikel

«Natürlich ist gesund, Chemie ist Gift»
Alles, was in der Natur vorkommt, ist gesund und synthetisch hergestellte Stoffe, also «chemische» Substanzen, sind giftig. Dieser Mythos ist schnell zu entkräften: In der Natur kommen viele hochgiftige Stoffe vor und gleichzeitig gibt es viele synthetisch hergestellte Substanzen, welche ungefährlich sind.

«Streichkonzert» bei Pflanzenschutzmitteln
In der Schweiz verlieren immer mehr Pflanzenschutzmittel die Zulassung der Behörden. Gleichzeitig gelangen kaum neue Mittel auf den Markt. Die Zulassungsbehörden sind massiv überfordert. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Das Risiko für Resistenzbildungen und Ernteausfälle steigt mit jedem Produkt, das vom Markt verschwindet.

Wissenschaft belegt konkrete Vorteile neuer Züchtungsmethoden
Die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) sieht grosse Chancen in neuen Züchtungsmethoden. Die Akademie stellt in einem neuen Dossier fünf Pflanzen vor, die mittels Genom-Editierung gezüchtet werden und auch für die Schweizer Landwirtschaft grosses Potenzial mit sich bringen. Die Publikation unterstreicht die Einigkeit der Wissenschaft zum Thema Genschere. Die neue Züchtungsmethode hat einen grossen Nutzen für Umwelt und Landwirtschaft.

Wissenschaftlich bewerten statt pauschal verbieten
Die Diskussion um PFAS gewinnt in der Schweiz an Dynamik. Im Zentrum stehen Fragen zu möglichen Gesundheits- und Umweltrisiken sowie der künftigen Regulierung. Dabei ist ein differenzierter, wissenschaftsbasierter Ansatz zentral – darauf weist scienceindustries im Rahmen eines Kurzinterviews mit Dominique Werner, Leiter Chemikalienregulierung, hin.

Schnellere Zulassung für Pflanzenschutzmittel längst überfällig
Die Schweiz verbietet fleissig Wirkstoffe, die auch in der EU vom Markt genommen werden. Umgekehrt steht sie auf der Bremse: Moderne Mittel, die in Nachbarländern zugelassen sind, bleiben blockiert. Mit der Annahme der Änderung des Landwirtschaftsgesetzes hat der Nationalrat nun aber einen wichtigen Schritt für die schnellere Zulassung von Pflanzenschutzmitteln getan.

Unterschiedliche Wahrnehmungen
Während die zunehmende administrative Belastung in der Wirtschaft als Hauptsorge wahrgenommen wird, sehen es Teile der Bevölkerung anders. Derweil werden Regulierungen immer wieder auch als Machtmittel im Konkurrenzkampf missbraucht – zum Leidwesen der KMU.

Inländische Produktion als blinder Fleck
Die Ernährungssicherheit der Schweiz steht zunehmend unter Druck: Die katastrophale Weizen- und Kartoffelernte vom letzten Jahr sorgte für eine zunehmende Importabhängigkeit. Doch der Bericht des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) schweigt weitgehend über die prekären Zustände der einheimischen Landwirtschaft. Die IG BauernUnternehmen hat deshalb den Bund scharf kritisiert.

