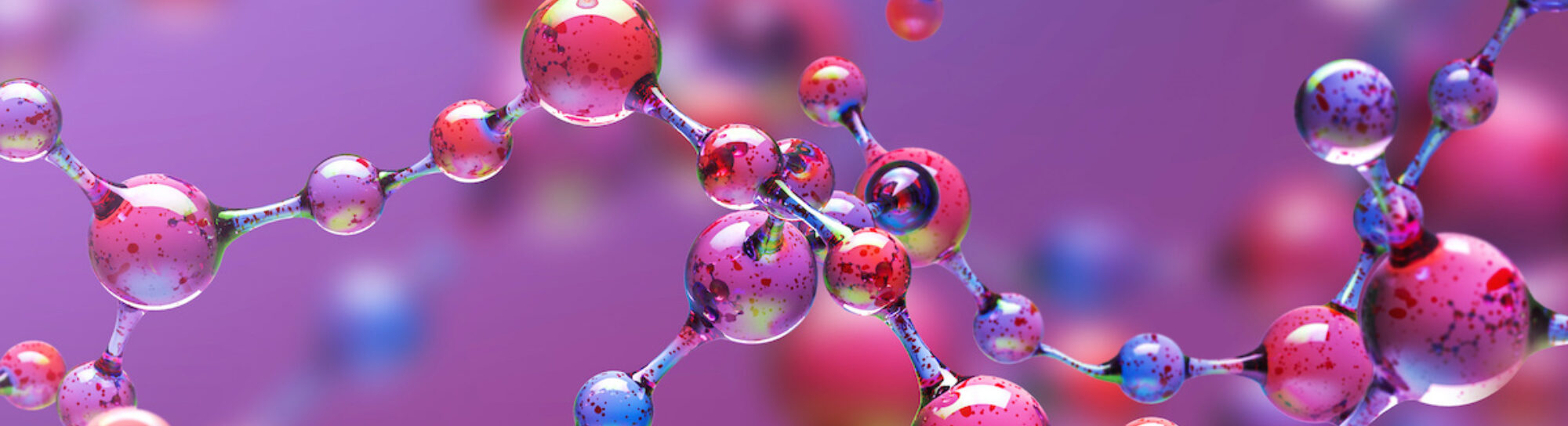
Vom Molekül zum Pflanzenschutzmittel
Weltweit werden jährlich im Schnitt noch fünf Pflanzenschutzmittel für den Markt zugelassen. Neuentwicklungen sind anspruchsvoll, zeitaufwendig und teuer. Von der Suche nach einer geeigneten Substanz bis zur Zulassung des marktfertigen Produkts vergehen heutzutage über zwölf Jahre. Die Kosten belaufen sich auf über 300 Millionen US-Dollar. Jedes neue Pflanzenschutzmittel muss strenge Anforderungen erfüllen. Die Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel sind vergleichbar mit denen für neue Medikamente.
Mittwoch, 18. Dezember 2024
Das Wichtigste in Kürze
Die Entwicklung eines neuen Pflanzenschutzmittels dauert in der Regel mehr als zwölf Jahre.
Die Kosten belaufen sich auf über 300 Millionen Dollar.
Neue Wirkstoffe durchlaufen ein strenges Zulassungsverfahren, um Risiken für Mensch und Umwelt zu minimieren.
Die akute Toxizität hat seit den 1960er Jahren um 40 Prozent abgenommen.
Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen
Die Landwirtschaft steht immer neuen Herausforderungen gegenüber. Verlieren bestehende Lösungen ihre Wirksamkeit, wird der Ruf nach neuen laut. Die Pflanzenschutzindustrie forscht darum schon heute nach Innovationen für die Herausforderungen von morgen. Sie muss jetzt abschätzen, was in zehn bis 15 Jahren gebraucht wird. Bei der Suche nach Wirkstoffen und der Entwicklung neuer Pflanzenschutzmittel spielen Sicherheit und Umweltverträglichkeit eine zentrale Rolle.
Die Entwicklung eines neuen Produkts zur Schädlingsbekämpfung beginnt mit der Suche nach vielversprechenden aktiven Substanzen – ein Prozess, der der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht. Oft untersuchen Biochemikerinnen und Wissenschafter mehr als 150'000 potenziell wirksame Moleküle oder molekulare Verbindungen, um viele Jahre später ein einziges Produkt auf den Markt zu bringen. Die Forschenden gehen keinesfalls willkürlich vor, sondern verfolgen einen klar strukturierten Designprozess. Dabei bedienen sie sich modernster 3D-Modellierungsprogramme, die es ermöglichen, die Molekülstrukturen am Computer passgenau zu designen. Anhand der am Computer projizierten Modelle werden die vielversprechendsten aktiven Substanzen synthetisiert, also im Labor hergestellt.
Die synthetisierten Substanzen durchlaufen zahlreiche Tests auf Wirkung und Nebenwirkungen – zuerst im Labor und anschliessend im Gewächshaus auf den Kulturpflanzen. Von Anfang an haben die möglichen Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt höchste Priorität. Gleichzeitig wird geprüft, ob der Wirkstoff in der vorgesehenen Anwendung tatsächlich wirksam ist. Bei jedem Übergang von einem Testsystem zum nächsten scheiden viele Substanzen aus, da sie die hohen Anforderungen nicht erfüllen. Nur eine Handvoll der ursprünglich 30'000 bis 40'000 synthetisierten Substanzen schafft es schliesslich in die Feldversuche.
Die Formulierung macht das Mittel
Für die wenigen Substanzen, die alle Tests erfolgreich bestanden haben, suchen Chemiker und Analytikerinnen eine geeignete Formulierung. Die Substanz alleine ist nämlich noch kein Pflanzenschutzmittel. Der reine Wirkstoff ist meist nicht applizierbar und wirkt nicht ausreichend. Dazu braucht es die richtige Rezeptur, die sogenannte Formulierung. Erfolgsversprechende Wirkstoffe werden mit Formulierungshilfsstoffen kombiniert. Diese Additive beeinflussen, wie gut ein Tropfen auf dem Blatt haftet, sich verteilt und durch die Wachsschicht der Blätter in das Pflanzeninnere gelangt. Eine gute Formulierung ist die Basis für eine präzise Ausbringung von Pflanzenschutzmittel – und damit ein essentieller Bestandteil der digitalen Landwirtschaft. Diese erste Phase der Herstellung eines neuen Pflanzenschutzmittels ist die kostenintensivste und beläuft sich im Schnitt auf 64 Millionen US-Dollar pro neuem Mittel.
Die neue Formulierung muss sich anschliessend in weiteren Feldversuchen bewähren. Diese kosten etwa 58 Millionen US-Dollar und dienen nicht nur der Optimierung der Wirksamkeit des Produkts, sondern auch der Gewinnung vieler für die Registrierung notwendiger Umweltdaten. Für die eigentliche Zulassung fallen dann noch einmal durchschnittlich 42 Millionen US-Dollar an – mehr als dreimal so viel wie 1995. Ein Grossteil dieser Kosten entfällt auf die Vorbereitung des umfangreichen Registrierungsdossiers für die Zulassungsbehörden.
Zulassung – eine Mammutaufgabe
Bevor ein neues Pflanzenschutzmittel auf den Markt kommt, muss es auch in der Schweiz von staatlichen Behörden zugelassen werden – hier durch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Eine Zulassung wird nur für Produkte erteilt, deren Herkunft, Zusammensetzung, Anwendung, Wirksamkeit sowie toxikologische, ökotoxikologische und umweltrelevante Eigenschaften vom Hersteller gemäss den BLV-Kriterien geprüft wurden.
Die Arbeiten zur Registrierung und Zulassung laufen parallel zur Entwicklung eines neuen Pflanzenschutzmittels. Die Hersteller führen über 100 umfangreiche wissenschaftliche Studien nach internationalen Qualitätskriterien durch. Diese Studien werden zusammen mit dem Registrierungsdossier beim BLV eingereicht. Die wissenschaftliche Beurteilung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU), dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) sowie dem BLW und der Forschungsanstalt Agroscope. Erst wenn sichergestellt ist, dass das neue Pflanzenschutzmittel bei vorschriftsgemässem Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt hat, wird es zugelassen und darf in Verkehr gebracht werden.

Aufgrund des aufwendigen Forschungsprozesses und der anspruchsvollen Zulassungsverfahren zählen Pflanzenschutzmittel zu den am besten untersuchten chemischen Substanzen. Jeder neue Pflanzenschutzwirkstoff muss jahrelange Versuchsreihen und Prüfungen durchlaufen. Ziel der Forschung ist neben der Entwicklung neuer Mittel vor allem die Minimierung unerwünschter Nebenwirkungen. Pflanzenschutzmittel sind im Zeitverlauf immer sicherer für Mensch und Umwelt geworden. Die akute Toxizität hat seit den 1960er Jahren um 40 Prozent abgenommen.
Davon profitieren Landwirtschaft und Verbraucher weltweit.
Technologischer Fortschritt in der Landwirtschaft
In den letzten Jahrzehnten hat der technologische Fortschritt dafür gesorgt, dass das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln deutlich präziser geworden ist. Es müssen dadurch weniger Mittel eingesetzt werden als früher. Eine gute Formulierung ist die Basis für eine präzise Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln – und damit ein essentieller Bestandteil der digitalen Landwirtschaft.
Sources
Ähnliche Artikel

Zulassungsstau wegen Umweltorganisationen
Schweizer Bauern können ihre Kulturen immer weniger gegen Schädlinge und Pilzkrankheiten schützen. Dies berichtet der «Nebelspalter». Die Zahl der zugelassenen Pflanzenschutzwirkstoffe hat seit 2005 drastisch abgenommen.

700 Pflanzenschutzmittel warten auf Zulassung
In der Schweiz warten unzählige Pflanzenschutzmittel auf eine Zulassung durch die Behörden. Diese können mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Das ist verheerend für die Landwirte, aber auch für die Umwelt.

Zulassung neuer Pflanzenschutzmittel: Bund zaudert, Parlament macht Druck
In der Schweiz harzt es bei der Zulassung neuer Pflanzenschutzmittel. Und es herrscht eine störende Asymmetrie. Der Bund entzieht Pflanzenschutzmitteln, welche die EU vom Markt nimmt, sofort die Bewilligung.

Warum der Verzicht auf synthetische Pestizide die Nahrungsmittelproduktion verringern wird
Der britische Aktionsplan zur Reduktion von Pestiziden droht laut Agronom Greg Dawson nach hinten loszugehen: Zu strenge Vorgaben könnten die heimische Landwirtschaft unrentabel machen – und Grossbritanniens Abhängigkeit von Importen erhöhen.

Studien zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln sind wissenschaftsbasiert
Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln unterliegt in der Schweiz strengen gesetzlichen Vorgaben. Letztlich basiert die Zulassung auf wissenschaftlich fundierten Studien. Diese Studien werden von den Herstellern finanziert, jedoch unterliegen sie klar definierten staatlichen Anforderungen und Kontrollen. Ziel ist es, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit sicherzustellen.

Kornkäfer frisst sich durch Schweizer Getreidelager
Der Kornkäfer breitet sich in Schweizer Getreidelagern aus. Eingeschleppt über den internationalen Handel, gefährdet er Ernten und verschlechtert die Qualität von Lebensmitteln.

Neues Problem Weichwanzen: Einheimische Schädlinge entdecken Gemüse und Obst
Weichwanzen breiten sich in rasantem Tempo auf Feldern und in Gewächshäusern in Süddeutschland aus. Die Schädlinge zerstören Gemüse und Obst – und bringen die Landwirtschaft an ihre Grenzen. Um Ernten zu sichern, braucht es dringend wirksame Pflanzenschutzmittel.

