
Weinbau: Auch PIWI-Sorten brauchen Pflanzenschutz
Der nasse Sommer 2021 verursachte grosse Schäden in Schweizer Weinbergen. Insbesondere Pilzkrankheiten wie der Falsche Mehltau setzten den Reben zu. Eine Umfrage der kantonalen Fachstellen für Rebbau der Deutschschweiz zeigt, dass auch PIWI-Sorten vom Falschen Mehltau betroffen sind und für den Schutz der Ernte Pflanzenschutzmittel benötigt werden.
Freitag, 24. Juni 2022
Wie das Fachmagazin «Obst- und Weinbau» berichtet, hatten im vergangenen Sommer auch sogenannte PIWI-Sorten (pilzwiderstandsfähige Sorten) mit Pilzbefall zu kämpfen. Dies geht aus einer Umfrage bei rund 130 Weinproduzentinnen und Produzenten hervor. Demnach waren rund 73 Prozent der berücksichtigten PIWI-Flächen von Falschem Mehltau betroffen. Bei den Standard-Sorten waren es 96 Prozent der Parzellen, die von der Pilzkrankheit betroffen waren. Die PIWI-Sorten waren gemäss Umfrage auch erst zu einem späteren Zeitpunkt von der Krankheit befallen. Bei den Standardsorten wurden bereits vor der Blüte Symptome des Falschen Mehltaus entdeckt. Bei den PIWI-Sorten erst in der Zeitspanne zwischen Blüte und Traubenschluss.
Mehr Behandlungen in schwierigen Jahren
Deutliche Unterschiede zeigen sich auch beim Traubenbefall. Während bei den Standardsorten nur 9 Prozent der Parzellen keinen Traubenbefall aufwiesen, waren es bei den PIWI-Sorten 50 Prozent. Obwohl sich PIWI-Sorten resistenter gegenüber dem Falschen Mehltau erweisen als Standardsorten, kommen auch sie nicht ohne Pflanzenschutzmittel aus. In normalen Jahren benötigen sie gemäss «Obst- und Weinbau» zwei bis drei Behandlungen mit Kupfer und Schwefel. Im letzten Jahr waren je nach Sorte bis zu fünf Behandlungen erforderlich.
Blindspot-Artikel
Sources
Ähnliche Artikel
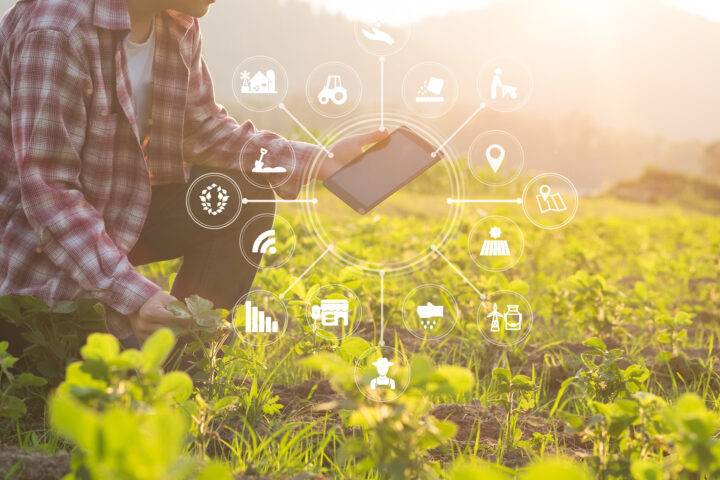
Revolution auf dem Bauernhof
Die CRISPR/Cas-Methode wird Teilbereiche der Pflanzenzüchtung revolutionieren. Die Technologie ist dringend nötig, um die Herausforderungen zu bewältigen, die sich der Landwirtschaft in diesem Jahrhundert gegenüberstellen und unsere Versorgungssicherheit gefährden.

Wie unser Alltag ins Wasser gelangt
Wenn über Rückstände in unseren Gewässern berichtet wird, gerät oft die Landwirtschaft als Hauptverursacher ins Visier. Doch eine differenzierte Betrachtung zeigt: Die Quellen sind vielfältig und liegen oft näher im Alltag, als vermutet wird.

Neue Züchtungsmethoden am Scheideweg
Bald wird sich weisen, ob auch auf europäischen Feldern in Zukunft Pflanzen aus moderner, genomischer Züchtung angepflanzt werden dürfen. Gerade die Schweiz ist gut beraten, zumindest hier auf die Entscheide in Brüssel zu schielen, um nicht den Anschluss zu verpassen.

Warum strenge Gentech-Regulierung Innovation bremst
Neue Züchtungsmethoden wie Crispr-Cas gelten als Schlüssel für resistente Pflanzen, stabile Erträge und weniger Pflanzenschutz. ETH-Professor Bruno Studer warnt: Wer diese Technologien überreguliert, stärkt ausgerechnet jene grossen Agrarfirmen, die man eigentlich bremsen will.

Superfood mit Ecken und Kanten
Die Süsslupine ist Biovisions «Superfood des Jahres 2026». Sie liefert viel Protein, verbessert Böden und fördert die Biodiversität. Doch der Blick auf die Praxis zeigt: Ohne Züchtung, Pflanzenschutz und Innovation bleibt auch dieses Superfood eine Herausforderung.

