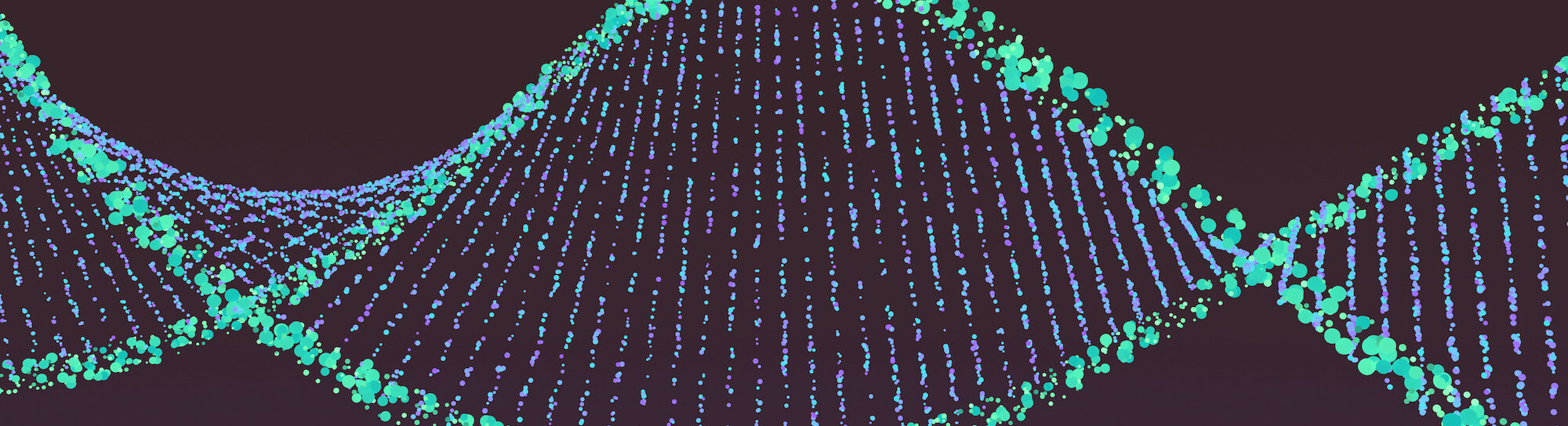
Argumente für neue Züchtungstechnologien
Pflanzenzucht ist komplex. Entsprechend viele Fragen gibt es in der Diskussion rund um neue Züchtungsmethoden. swiss-food.ch hat die wichtigsten Fragen und Antworten zu neuen Züchtungstechnologien zusammengestellt.
Sonntag, 20. März 2022
Der wissenschaftliche Konsens bezüglich der Sicherheit der modernen Züchtungsverfahren ist gross. Die modernen Züchtungsmethoden sind viel genauer als viele der klassischen Ansätze, die in der Schweiz schon lange angewendet werden und ebenfalls ins Genom der Pflanze eingreifen. Für führende Forschende im Feld ist klar: Zu behaupten, es fehle eine entsprechende Datengrundlage, ist schlichtweg falsch.
Zur Gentechnik wird seit Jahrzehnten geforscht. Die potenziellen Risiken, auch in Bezug auf neue Verfahren, wurden immer wieder untersucht. Von gentechnisch modifizierten Pflanzen geht kein grösseres Risiko aus als von herkömmlichen Züchtungen. Das bestätigte 2012 auch das Nationalfondsprojekt 59 (NFP 59). Der wissenschaftliche Konsens ist vergleichbar mit demjenigen zur menschlich verursachten Klimaerwärmung. Eine Umfrage unter rund 2000 amerikanischen Wissenschaftlern aus den Bereichen Biologie und Biochemie zeigte bereits 2014, dass 91 Prozent der Befragten den Verzehr von genetisch veränderten Lebensmitteln als völlig unbedenklich erachten.
Das gilt auch in Bezug auf die neuen präziseren Züchtungsmethoden. Anwendungen der Genom-Editierung sind genauer und verursachen nachweislich weniger so genannte «Off-Target-Effekte» (Mutationen an unerwünschter Stelle) als bereits heute zugelassene Methoden wie beispielsweise die klassische Mutagenese. Die Schweizer Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) weist denn auch verschiedentlich darauf hin, dass die naturwissenschaftlichen Grundlagen als ausreichend angesehen werden können, um die gesetzlichen Bestimmungen dem heutigen Erkenntnisstand anzupassen und dass für die Regulierung die Züchtungstechniken künftig keine Rolle mehr spielen, sondern nur noch das Produkt, also die Pflanze mit ihren neuen Eigenschaften.
Das bestätigt auch Prof. Wilhelm Gruissem von der ETH Zürich, der bereits am NFP 59 massgeblich beteiligt war. Er weist in einem Interview darauf hin, dass es zahlreiche Studien gibt, die belegen, dass auch die neuen Züchtungsmethoden, genauso wie herkömmliche Züchtungsmethoden, unter überschaubarem Risiko angewendet werden können. Angesichts dessen ist die Behauptung, es gäbe keine belastbaren Daten und nur geringe Erkenntnisse bezüglich der neuen genomischen Verfahren, wie sie auch im Rahmen der Debatte in Nationalrat gemacht wurden, aus der Luft gegriffen.
Diese und weitere Argumente finden Sie in unserem ausführlichen Q&A zu den neuen Züchtungstechnologien nachnachfolgend zum Herunterladen.
Sources
Ähnliche Artikel

Was wirklich im Einkaufskorb steckt
Gentechnik im Einkaufskorb? Ja – und viel häufiger, als wir denken. Ob Pasta, Brot oder Gemüse: Viele unserer Alltagsprodukte stammen aus Mutationszüchtungen, die ein Eingriff ins Genom sind und als sicher gelten. Höchste Zeit, mit gängigen Mythen aufzuräumen.

Die genomischen Züchtungsmethoden bekommen keine Chance, sich zu beweisen
Moderne genomische Züchtungsmethoden gelten rechtlich als Gentechnik – und sind deshalb bis heute faktisch blockiert. Dabei essen wir seit Jahrzehnten gentechnisch veränderte Pflanzen, nur unter dem Etikett «klassische Mutagenese». Die neuen, präziseren Verfahren werden strenger reguliert als die alten, obwohl sie wissenschaftlich als sicherer gelten. Ein Widerspruch, der dringend korrigiert werden müsste. Die EU geht mit gutem Beispiel voran..

Keine Schweinerei: Warum hodenlose Eber ein klares Plus fürs Tierwohl sind
Neue Züchtungsmethoden eröffnen neue Möglichkeiten in der Pflanzen- und Tierzucht. Sie erlauben gezielte Veränderungen im Erbgut, die auch Tiere widerstandsfähiger, anpassungsfähiger und gesünder machen können.

Stillstand statt Fortschritt: Die Schweiz droht bei neuen Züchtungen zurückzufallen
Ein Überblicksartikel im Schweizer Bauer zeigt, wie stark die neuen Züchtungsmethoden die bäuerlichen Kreise beschäftigen. Nach Abschluss der Vernehmlassung zum Bundesgesetz wird eine Vorlage erwartet – dann zeigt sich, ob der politische Wille zur Zulassung tatsächlich besteht.

