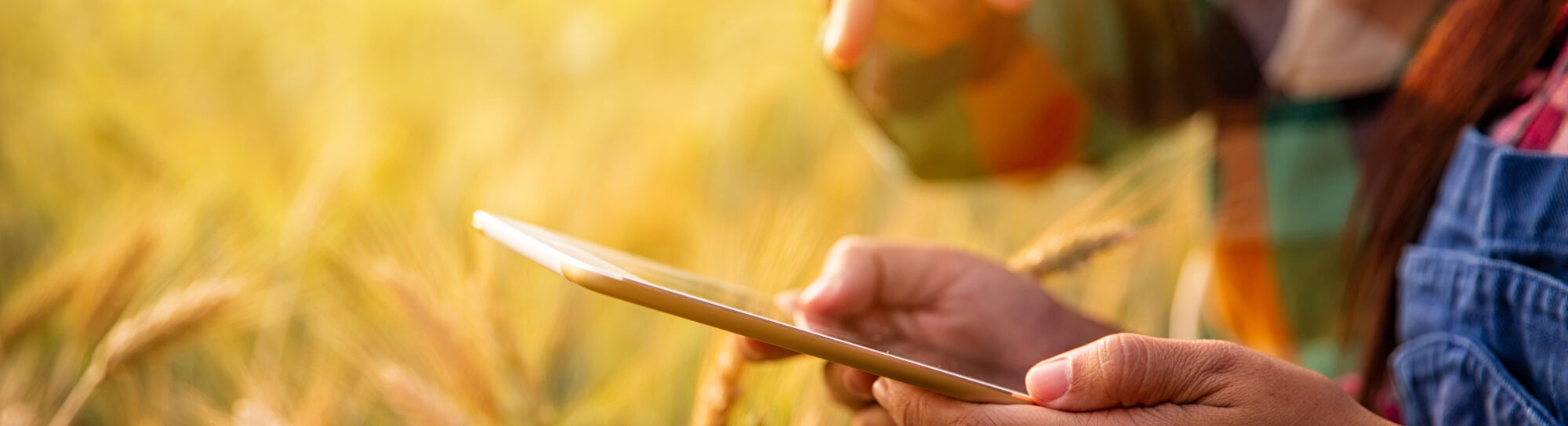
Hightech im Pflanzenschutz: «GPS statt Feuerwehrschaum»
Technologischer Fortschritt und Digitalisierung machen auch vor der Landwirtschaft nicht halt. Insbesondere der Pflanzenschutz erfährt dank Hightech eine stetige Effizienzsteigerung. Das kommt vor allem der Umwelt zugute. Wir haben Werner Rüttimann begleitet. Er unterstützt als Lohnunternehmer Bauern beim Pflanzenschutz.
Mittwoch, 29. Januar 2020
Das Wichtigste in Kürze:
- Die Digitalisierung hält auch in der Landwirtschaft Einzug.
- Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erfolgt heute mithilfe von Software und GPS.
- Von der exakten Ausbringung profitieren Landwirte und Umwelt gleichermassen.
Wenn Werner Rüttimann einen Pflanzenschutzauftrag ausführt, setzt er sich nicht gleich auf sein Spritzfahrzeug. Als erstes schreitet er zu Fuss das zu bearbeitende Feld ab. Er checkt das Stadium der Kulturen oder die Schadenschwelle der Schädlinge, um auch den richtigen Zeitpunkt für die Behandlung zu erwischen. Denn nur dann macht der Einsatz der Pflanzenschutzmittel überhaupt Sinn. Sobald er vom Feld zurückgekehrt ist, folgt die Arbeit am Laptop. Er plant jeden Einsatz minutiös. Ganz ähnlich wie ein Pilot seinen Flug. Die Zeiten, als ein Landwirt mehr oder weniger nach Augenmass und Gefühl seine Mittel ausgebracht hat, sind längst vorbei. Die Planung des Auftrages erfolgt mit einer speziellen Software. Diese gibt aufgrund der bereits auf demselben Feld absolvierten Einsätze und mithilfe von Google-Maps eine präzise Planungsgrundlage ab. Ziel ist es, keine Pflanzenschutzmittel zu viel auszubringen. «Abgesehen davon, dass der Bauer dabei Geld spart, geht es vor allem um die Minimierung der Umweltauswirkungen», erklärt Werner Rüttimann die minutiöse Planung.
Hochpräzise dank GPS
Sind die entsprechenden Füllmengen berechnet, die Mittel fachmännisch eingefüllt und die Maschine gecheckt, setzt sich Rüttimann ins Cockpit und fährt los. Während früher vor dem Erreichen des Feldes die Spritzen durch Ablassen des kontaminierten Reinigungswassers – vielfach auf Feldwegen – «scharf» gemacht werden mussten, sind sie heute dank modernem Ringleitungssystem ab der ersten Sekunde einsatzbereit. Zum Vorteil der Umwelt. Das eigentliche Ausbringen der Pflanzenschutzmittel ist dank Computerunterstützung eine hochpräzise Angelegenheit. GPS-Steuerung und die Möglichkeit, einzelne Düsen computergesteuert ein- und auszuschalten, vermeiden unnötige Flächenüberschneidungen beim Spritzen fast vollständig. «Früher haben wir als Markierung der bereits behandelten Flächen Feuerwehrschaum verwendet. Heute fahren wir dank GPS fast zentimetergenau über die Felder. Die Software sorgt dafür, dass nur diejenigen Düsen aktiv sind, welche auch wirklich gebraucht werden», erklärt Rüttimann die grossen technischen Fortschritte.
Fast schon wie ein Flugzeugcockpit
Doch GPS ist bei weitem nicht das einzige technische Hilfsmittel. In einem modernen Spritzfahrzeugs sieht es vielmehr aus wie in einem Flugzeugcockpit. Diverse Monitore dienen der Steuerung und Überwachung der Spritzen. So kommen zum Beispiel Ultraschall, Hygrometer oder Windmesser zum Einsatz, alles auf digitaler Basis, versteht sich. «Damit können wir die Effizienz noch mehr steigern. Zeigt zum Beispiel das Hygrometer zu trockene Luft an, brechen wir die Behandlung ab. Ultraschall dient dazu, den idealen Abstand zum Boden oder den Pflanzen zu halten. Auch zu viel Wind ist ein Grund, unseren Einsatz neu zu planen.» Dies alles hilft, die Umwelt zu schonen. Eine zusätzliche Effizienzsteigerung bringt der Einsatz moderner Steuerungssoftware. Sie sorgt dafür, dass die berechnete Menge an Pflanzenschutzmittel regelmässig und bis zum letzten Tropfen genau ausgebracht wird, angepasst an die aktuelle Fahrgeschwindigkeit und die Umwelteinflüsse. Zudem kann heute dank Ultraschall und GPS auch in der Nacht genau gleich präzise gefahren werden wie bei Tageslicht. Nachteinsätze sind vor allem zum Schutz gewisser Insektenarten, insbesondere der Bienen, wichtig.
Anstatt Sprühnebel gezielte Anwendung
Doch der grösste technische Fortschritt hat in den letzten Jahren bei der Düsentechnik stattgefunden. Kamen früher simple Flachstrahldüsen zum Einsatz, setzen die Pflanzenschützer seit einigen Jahren immer mehr auf moderne Injektordüsen. Diese sind dank grösseren Tropfen deutlich weniger windanfällig. Damit kann die sogenannte Abdrift fast vollständig verhindert werden, also das Verfrachten von Pflanzenschutzmitteln auf Flächen ausserhalb der zu behandelnden Bereiche. Injektordüsen erlauben auch eine bessere Durchdringung und steigern damit die Effizienz weiter. Die moderne Technik lässt sich auch als Laie von aussen deutlich erkennen: Zog früher eine Spritzmaschine einen feinen Nebel hinter sich her, sind bei modernen Systemen die Spritzmittel kaum mehr von Auge zu erkennen.
Die Entwicklung geht zum Wohl der Umwelt weiter
Unter dem Strich werden durch den technologischen Fortschritt und die Digitalisierung deutlich weniger Pflanzenschutzmittel benötigt. Dies kommt vor allem auch der Umwelt zugute. Die Entwicklung geht aber weiter und es ist zu erwarten, dass in Zukunft noch effizienter gearbeitet werden kann. «Ein grosses Potenzial liegt auch darin, dass wirklich alle auf die modernste Technik umstellen. Dies wird in den nächsten Jahren nochmals einen Effizienzschub geben», blickt Rüttimann zuversichtlich in die Zukunft. Sagt es und fährt auf den modernen Waschplatz, um die Geräte fachmännisch und umweltschonend zu reinigen. Zumindest dies ist solide Handarbeit. Noch.
Ähnliche Artikel

Globale Fakten zu Welternährung und Landwirtschaft
Nur dank technologischem Fortschritt und modernem Pflanzenschutz werden wir in Zukunft unsere Ressourcen schonen und gleichzeitig immer mehr Menschen gesund und erschwinglich ernähren können.

Pestizide in grünen Smoothies
Nach den zahlreichen Rezepten für Weihnachtsplätzchen, Festtagsbraten und Cocktails sind jetzt die Tipps fürs Abnehmen, Entschlacken und Verschönern gesetzt. Das meiste ist blanker Unsinn. Das schreibt Gastautor und Wissenschaftsjournalist Ludger Wess in seinem Artikel.

Natürliche Gifte: Unterschätzte Gefahr in unserer Nahrung
Sichere Lebensmittel sind keine Selbstverständlichkeit. Während oft chemische Stoffe in der Kritik stehen, zeigt die Realität: Die grössten Risiken für unsere Lebensmittelsicherheit sind natürlichen Ursprungs. Rückrufe bei Babynahrung zeigen, wie tückisch Bakteriengifte oder Schimmelpilze sind.

Mit Tee krank statt schlank
Pflanzenschutzmittel stehen häufig im Fokus öffentlicher Kritik. Weniger beachtet wird, dass auch natürliche Inhaltsstoffe in Tees und Nahrungsergänzungsmitteln wirksam sind und gesundheitliche Risiken bergen können.

