
Rückstände, Grenzwerte, Vertrauen – sachlich hinter die Schlagzeilen schauen
Im Gespräch mit dem Fachtoxikologen Lothar Aicher geht es darum, wie Rückstände vom Körper aufgenommen werden, wie deren Gefährlichkeit bewertet wird und welche Rolle moderne Analytik spielt.
Montag, 17. November 2025
«Pflanzenschutzmittel sind neben den Medikamenten jene Stoffe, die mit Abstand am besten untersucht sind», heisst es in der zweiten Episode der Serie von Agrarpolitik – der Podcast und swiss-food.ch. Dennoch bleibt die öffentliche Debatte oft an der Oberfläche. Zu häufig stehen Grenzwertüberschreitungen und Schuldzuweisungen im Vordergrund, während die komplexen Hintergründe von Politik, Forschung und landwirtschaftlicher Praxis kaum Beachtung finden.
Aicher erläutert dabei nicht nur, wie Rückstände über Lebensmittel, die Haut und den Atem aufgenommen werden, sondern auch, wie der Körper mit diesen Chemikalien umgeht und welche biologischen Abbauprozesse relevant sind.
Der Podcast lädt dazu ein, die Diskussion zu versachlichen: Es geht nicht darum, Angst zu schüren, sondern darum zu erklären, wie Grenzwerte entstehen, wozu sie dienen, welche Unsicherheiten bestehen und wie Risiken realistisch eingeschätzt werden. Konsument:innen nehmen in der Regel nur geringe Mengen auf, das Risiko ergibt sich aus der Giftigkeit eines Stoffes, der aufgenommenen Menge und der Häufigkeit.
Zur gesamten Serie Agrarpolitik – der Podcast mit swiss-food
Der Agrarpolitik-Podcast und swiss-food.ch beleuchten in einer gemeinsamen Serie, wie wir in der Schweiz mit Risiken, Messwerten und Wahrnehmungen von Chemikalien umgehen – sachlich, verständlich und praxisnah.
Den krönenden Abschluss bildete der Live-Event im Bogen F in Zürich.
Zu den Folgen:
Folge 1 mit Dr. Angela Bearth (Hier zur Folge)
Folge 2 mit Dr. Lothar Aicher (Hier zur Folge)
Folge 3 mit Dr. Michael Beer (Hier zur Folge)
Folge 4 mit Christine Badertscher (Hier zur Folge)
Aicher erklärt zudem, wie die Gefährlichkeit von Chemikalien ermittelt wird: Grundlage bilden kontrollierte toxikologische Studien – häufig Tierversuche –, deren Ergebnisse in gesetzlich definierte Sicherheitsfaktoren einfliessen. Dazu zeigt er, warum Alternativen zu Tierversuchen zunehmend wichtiger werden, sowohl aus ethischer, als auch aus wissenschaftlicher Perspektive.
Auch die Frage, wie das Risiko von Rückständen verringert werden kann, wird thematisiert: durch gute landwirtschaftliche Praxis, sachgemässe Anwendung und wirksame Kontrollen. Nur wenn diese Zusammenhänge klar vermittelt werden, können Vertrauen und sachlicher Dialog entstehen – die Basis für gegenseitiges Verständnis und praktikable Lösungen in der Chemikalienregulierung und im Pflanzenschutz. Ein weiterer Schwerpunkt der Episode ist PFAS: Aicher macht deutlich, weshalb PFAS reduziert oder ersetzt werden sollten.
Zugleich zeigt die Episode, dass öffentliche Diskussionen oft emotional geführt werden, obwohl die wissenschaftliche Bewertung solide ist. Aicher beschreibt anschaulich, warum wir Gefahren manchmal falsch einschätzen – und betont: «Wir schätzen Risiken dann geringer ein, wenn wir einen Vorteil für uns sehen.» So ist zweifellos auch Alkohol ein Gift – insbesondere, wenn das Genussmittel in hohen Dosen konsumiert wird. Klar ist: Wer die Mechanismen hinter Grenzwerten und Risikoeinschätzungen versteht, kann differenzierter urteilen und eine faktenbasierte Diskussion fördern.
Ähnliche Artikel

Wissenschaftler mahnen zur Vernunft
Am zweiten swiss-food-Talk sprachen Experten über den Umgang mit Grenzwerten und die teilweise falsche Interpretation im öffentlichen Diskurs. Die Wissenschaftler plädieren für mehr Sachlichkeit.
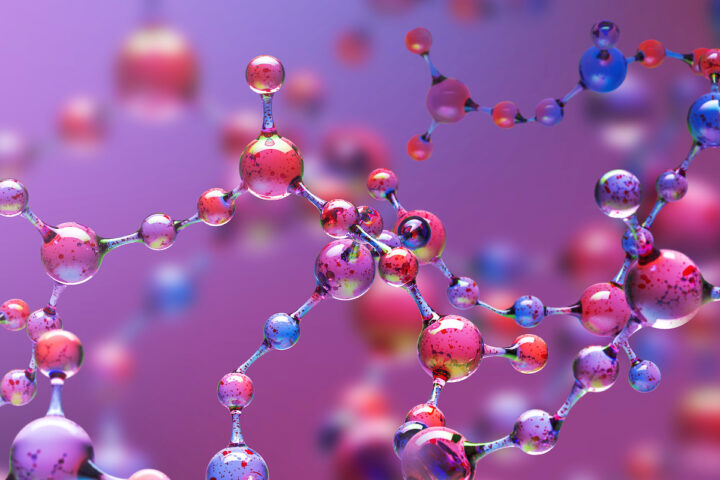
Vom Molekül zum Pflanzenschutzmittel
Weltweit werden jährlich im Schnitt noch fünf Pflanzenschutzmittel für den Markt zugelassen. Neuentwicklungen sind anspruchsvoll, zeitaufwendig und teuer. Von der Suche nach einer geeigneten Substanz bis zur Zulassung des marktfertigen Produkts vergehen heutzutage über zwölf Jahre. Die Kosten belaufen sich auf über 300 Millionen US-Dollar. Jedes neue Pflanzenschutzmittel muss strenge Anforderungen erfüllen. Die Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel sind vergleichbar mit denen für neue Medikamente.

Triazol im Genfersee: Behörden geben Entwarnung
Im Spätsommer 2025 sorgte die Nachricht für Aufsehen: Im Trinkwasser aus dem Genfersee wurde der Stoff 1,2,4-Triazol gefunden – eine chemische Verbindung, die aus verschiedensten Verwendungen stammt. Nun geben die Kantone Genf, Waadt und Wallis Entwarnung: Das Wasser kann bedenkenlos getrunken werden.

Globale Fakten zu Welternährung und Landwirtschaft
Nur dank technologischem Fortschritt und modernem Pflanzenschutz werden wir in Zukunft unsere Ressourcen schonen und gleichzeitig immer mehr Menschen gesund und erschwinglich ernähren können.

Pestizide in grünen Smoothies
Nach den zahlreichen Rezepten für Weihnachtsplätzchen, Festtagsbraten und Cocktails sind jetzt die Tipps fürs Abnehmen, Entschlacken und Verschönern gesetzt. Das meiste ist blanker Unsinn. Das schreibt Gastautor und Wissenschaftsjournalist Ludger Wess in seinem Artikel.

Natürliche Gifte: Unterschätzte Gefahr in unserer Nahrung
Sichere Lebensmittel sind keine Selbstverständlichkeit. Während oft chemische Stoffe in der Kritik stehen, zeigt die Realität: Die grössten Risiken für unsere Lebensmittelsicherheit sind natürlichen Ursprungs. Rückrufe bei Babynahrung zeigen, wie tückisch Bakteriengifte oder Schimmelpilze sind.

Mit Tee krank statt schlank
Pflanzenschutzmittel stehen häufig im Fokus öffentlicher Kritik. Weniger beachtet wird, dass auch natürliche Inhaltsstoffe in Tees und Nahrungsergänzungsmitteln wirksam sind und gesundheitliche Risiken bergen können.

