
Erst die Moral, dann das Essen
Gentechnologie in der Landwirtschaft – wo bleibt Röstis Technologieoffenheit?
Montag, 10. Februar 2025
Der Bundesrat hat dieser Tage eine Verlängerung des Gentechnik-Moratoriums ab Ende 2025 um fünf Jahre empfohlen, also bis Ende 2030. Damit geht er weiter als die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) des Nationalrats, die im Herbst eine Verlängerung um zwei Jahre bis Ende 2027 vorgeschlagen hatte.
Fünfjahresplan und Technologieverbot – wie passt das zu den Beteuerungen, die Schweiz sei spitze bei Innovationen? Wie passt das dazu, dass Bundesrat Rösti sonst von Technologieoffenheit spricht? Wie kommt die Regierung dazu, die Schweiz in der Entwicklung der Pflanzenzüchtung derart zu behindern, im Gefängnis zu behalten? Diesen Fragen geht Beat Gygi in seinem Bericht in der «Weltwoche» nach.
2005 hat eine entsprechende Volksinitiative zu einem Moratorium geführt mit dem Verbot für die Verwendung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in der Landwirtschaft. Es war befristet, vier Mal wurde es seither verlängert, zuletzt bis Ende 2025 – da immerhin verknüpft mit einem Funken Innovationshoffnung.
Denn zugleich sollte der Bundesrat neue Spielregeln für die Zulassung von Pflanzen aus neuen Züchtungstechnologien erarbeiten. Was steckt dahinter?
In jüngerer Zeit wurden neue gentechnische Verfahren erfunden, bei denen viel präziser als früher einzelne Gene an bestimmten Stellen des Genoms eingebracht werden oder gezielt aus- beziehungsweise eingeschaltet werden können. Wie dies beim Züchten auch passiert, aber schneller. «Editieren des Genoms» wird diese Art Züchten auch genannt, wie das Redigieren in einem Buch. Für die betreffende Methode Crispr-Cas erhielten 2020 Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna den Nobelpreis.
Entgegen früheren Erwartungen ist der Bundesrat noch nicht bereit mit den neuen Spielregeln, er will die Botschaft zum neuen Gesetz erst im ersten Quartal 2026 liefern.
Dass er nun aber das Moratorium gerade um volle fünf Jahre verlängern will, statt wie die Nationalratskommission um zwei, bedeutet eine lange Lähmung der Landwirtschaft und gravierende Verluste bei den Nahrungsmitteln. Nochmals: Warum provoziert die Regierung solche Schäden?
Es hängt mit dem Problem zusammen, das der französische Ökonom und Politiker Frédéric Bastiat (1801–1850) früh gesehen hat: Es geht um das, was man sieht, und das, was man nicht sieht.
Was man sieht: Auffällige Auswirkungen des Gentech-Verbots sind die politischen und wirtschaftlichen Erfolge der Gentech-Gegner, die daraus Kapital schlagen. Gegner aus der Landwirtschaft können so Konkurrenten von den Produktemärkten fernhalten, Agrarpolitiker können Stimmen gewinnen, ausserparlamentarische Kommissionen ihre Ideologie ausleben, und den NGOs, die auf Spenden ausgerichtet sind, hilft die Verbotspolitik beim Geldsammeln.
Was man nicht sieht: Die amtliche Lähmung der Züchtungstätigkeit verhindert neue Sorten, die etwa Kartoffeln, Weizen oder Mais widerstandsfähiger gegen Pilze, Schädlinge oder gegen Trockenheit machen. Hinzu kommt: Wenn die bäuerliche Bevölkerung nur zwei Prozent ausmacht, sind deren Probleme auf dem Feld erst recht kein Thema, die Ladenregale sind ja immer voll. So bleibt eine eigentlich mögliche Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung aus. Das ist das, was man nicht sieht.
Das, was man sieht, wirkt in der Politik kräftiger: die Inszenierung der Anti-Gentech-Gesinnung – erst kommt die Moral, dann das Essen.
Beat Gygi ist Journalist bei der «Weltwoche». Dieser Artikel ist als Erstveröffentlichung am 5. Februar in der «Weltwoche» erschienen.
Ähnliche Artikel

Vertrauen in bahnbrechende Innovationen
Eine globale Umfrage bei mehr als 13’000 Personen aus 13 Ländern zeigt, dass die Menschen gegenüber neuen Technologien grundsätzlich positiv eingestellt sind. Die Studie belegt zudem eine klare Korrelation zwischen Wissensstand und Einstellung: Je mehr die Menschen über eine Technologie wissen, desto positiver bewerten sie diese.
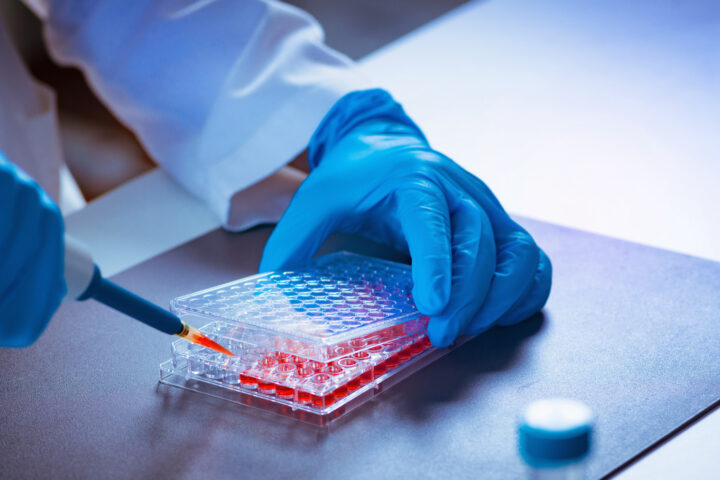
Forschung und Innovation nicht abwürgen
Ob 5G, Corona-Impfung oder Gentechnik. Die Widerstände gegenüber neuen Technologien scheinen im Moment Hochkonjunktur zu haben.

«Die Schweiz ist das patentintensivste Land der Welt»
Patente schützen Innovation und gleichzeitig treiben sie Innovation an. Am Swiss-Food Talk vom 15. August 2023 diskutierten drei Innovations-Experten über die Bedeutung von Patenten für die Schweizer Wirtschaft.

Warum strenge Gentech-Regulierung Innovation bremst
Neue Züchtungsmethoden wie Crispr-Cas gelten als Schlüssel für resistente Pflanzen, stabile Erträge und weniger Pflanzenschutz. ETH-Professor Bruno Studer warnt: Wer diese Technologien überreguliert, stärkt ausgerechnet jene grossen Agrarfirmen, die man eigentlich bremsen will – und schliesst kleinere Züchter und Start-ups vom Markt aus.

Superfood mit Ecken und Kanten
Die Süsslupine ist Biovisions «Superfood des Jahres 2026». Sie liefert viel Protein, verbessert Böden und fördert die Biodiversität. Doch der Blick auf die Praxis zeigt: Ohne Züchtung, Pflanzenschutz und Innovation bleibt auch dieses Superfood eine Herausforderung.

Verkaufsstopps wegen PFAS: Müssen wir uns Sorgen machen?
Nach spektakulären Verkaufsverboten für Fisch und Fleisch wegen PFAS-Belastungen stellen sich Konsumentinnen und Konsumenten die Frage: Wie gefährlich sind die Stoffe wirklich – und was landet noch bedenkenlos im Einkaufschörbli?

Wie deutsche Experten über neue Züchtungsmethoden denken
In kaum einem anderen Land wird die Bio-Landbau-Idylle in der Öffentlichkeit so gepflegt wie in Deutschland. Natürlichkeit und ländliche Ursprünglichkeit sind mentale Sehnsuchtsorte vieler Deutscher. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass der Widerstand gegen neue Züchtungsmethoden gross ist – und dass die Unkenntnis über den eigenen Bio-Landbau fast schon vorsätzlich wirkt.

