
Biotechnologie als Werkzeug für den Naturschutz
Neue genomische Technologien können helfen, bedrohte Arten zu retten – vom Kastanienbaum bis zum Weissen Breitmaulnashorn.
Dienstag, 21. Oktober 2025
Der Verlust an Biodiversität schreitet weltweit dramatisch voran. Über eine Million Arten sind laut Schätzungen vom Aussterben bedroht. Klassische Schutzmassnahmen – wie Lebensraumbewahrung, Zuchtprogramme oder die Bekämpfung invasiver Arten – stossen zunehmend an ihre Grenzen. Forschende und Naturschutzorganisationen prüfen deshalb, ob biotechnologische Verfahren künftig helfen können, Arten zu retten oder Ökosysteme zu stabilisieren, wie ein aktueller Beitrag auf der Plattform Genetic Literacy Project zeigt.
Die Rückkehr der amerikanischen Kastanie
Ein eindrückliches Beispiel ist dabei die amerikanische Kastanie. Einst prägte sie die Wälder im Osten der USA, bis ein eingeschleppter Pilz Anfang des 20. Jahrhunderts Milliarden Bäume vernichtete. Die sogenannte The American Chestnut Foundation (TACF) arbeitet seit über 30 Jahren daran, die Art zurückzubringen – durch klassische Züchtung mit Resistenzgenen der chinesischen Kastanie. Parallel kombiniert TACF diese Ansätze mit modernen Methoden wie genomischer Selektion und Speed Breeding, um die Entwicklung zu beschleunigen. Zudem kooperiert TACF mit dem SUNY College of Environmental Science and Forestry (SUNY-ESF), wo gentechnisch resistente Kastanienlinien entwickelt wurden. Dieses Nebeneinander von konventioneller Züchtung und gentechnischen Verfahren zeigt, wie sich klassische Methoden und Biotechnologie ergänzen können, um ein Ökosystem wiederzubeleben.
Das letzte männliche Breithornnashorn ist tot
Auf Inseln bedrohen eingeschleppte Ratten, Mäuse und andere Nagetiere zahllose endemische Vogel- und Insektenarten. Gifteinsätze oder Fallen sind oft teuer, schwer umzusetzen und mit ökologischen Unsicherheiten behaftet. Hier setzt das internationale Genetic Biocontrol of Invasive Rodents Consortium (GBIRd) an – mit Unterstützung durch Organisationen wie Island Conservation, die seit Jahren klassische Methoden einsetzen und nun genetische Ansätze wie Gene Drives erforschen. Ein solcher Gene Drive kann eine genetische Eigenschaft – etwa Unfruchtbarkeit – so weit verbreiten, dass eine invasive Population deutlich reduziert oder sogar lokal eliminiert werden könnte. Diese Technologie bietet potenziell eine präzisere und ökologisch verträglichere Kontrolle als herkömmliche Mittel.
Noch deutlicher wird das Potenzial biotechnologischer Verfahren beim nördlichen Breitmaulnashorn. Von dieser Art leben nur noch zwei unfruchtbare Weibchen, der letzte Bulle starb 2018. Forschende versuchen nun, mit In-vitro-Fertilisation, Stammzelltechnologie und genetischer Archivierung Embryonen zu erzeugen, die in verwandten Nashornarten eingesetzt werden könnten. Ohne biotechnologische Verfahren wäre diese Art unwiederbringlich verloren gegangen.
Wichtiger Entscheidung der IUCN: Wissenschaft statt Tabu
Ein markantes Signal für diesen Wandel im Naturschutz kam kürzlich von der International Union for Conservation of Nature (IUCN). Die IUCN ist die weltweit grösste Naturschutzorganisation, ein Zusammenschluss von mehr als 1400 Regierungs‑ und Nichtregierungsorganisationen aus über 160 Ländern. Sie erstellt wissenschaftlich fundierte Richtlinien, Bewertungsberichte und Empfehlungen, die oft die Grundlage für Naturschutzpolitik und -projekte weltweit bilden, etwa für die Rote Liste bedrohter Arten.
Auf ihrer letzten Jahrestagung haben die Mitglieder beschlossen, kein pauschales Verbot für die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) im Naturschutz zu unterstützen, sondern stattdessen eine wissenschaftlich fundierte, risikobasierte Bewertung zu befürworten. Obwohl die IUCN keine gesetzgebende Macht besitzt, hat ihre Entscheidung grosse symbolische Bedeutung – viele Staaten und Naturschutzprogramme orientieren sich an ihren Empfehlungen.
Neues Werkzeug im Werkzeugkasten des Naturschutzes
Die Integration biotechnologischer Verfahren in den Naturschutz ist ein bedeutender Schritt – gerade nun, wo die IUCN signalisiert hat, dass ein vollständiges Tabu weder wissenschaftlich begründet noch sachgerecht ist. Dafür müssen jedoch klare Kriterien, Monitoring, Rückfalloptionen und transparente Prozesse etabliert werden.
Gleichzeitig ist auch klar, dass Biotechnologie kein Ersatz für bewährte Schutzmethoden wie Lebensraumsicherung, Wiederansiedlungen oder invasive Artenkontrolle sind – sondern ein ergänzendes Werkzeug. Für Mitteleuropa könnte dies – etwa beim Waldschutz gegen neue Schädlinge oder beim Umgang mit invasiven Arten – künftig Relevanz gewinnen.
Die Biotechnologie im Naturschutz steht am Anfang: Statt nur zu dokumentieren, wie Arten verschwinden, könnten wir sie mit wissenschaftlicher Hilfe und kluger Regulierung erhalten – wenn wir bereit sind, alte und neue Ansätze verantwortungsvoll zu verbinden.
Ähnliche Artikel

Die Biotechnologie hat erst begonnen
Als Frank Schirrmacher am 27. Juni 2000 die Seiten des Feuilletons der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» freiräumte, um über sechs Seiten das soeben erstmals entzifferte menschliche Genom Buchstabe für Buchstabe zu publizieren, rückte die Biotechnologie erstmals in den Fokus der breiten Öffentlichkeit.

Der grosse Nutzen der Biotechnologie in der Landwirtschaft
Biotechnologisch gezüchtete Pflanzen werden seit rund 25 Jahren in vielen Teilen der Erde angebaut. Mehrere Publikationen belegen den grossen Nutzen der Biotechnologie in der Landwirtschaft. Der Anbau der Pflanzen wirkt sich positiv auf die Umwelt, das Klima und die Erträge von Bauern aus.
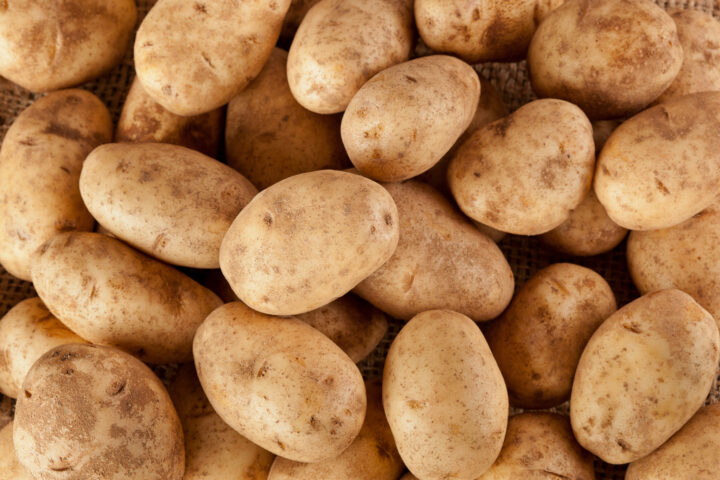
Biotech-Züchtung in Afrika nützt Kleinbauern
Krankheiten wie die Kraut- und Knollenfäule bedrohen nicht nur die Kartoffeln europäischer Landwirte. Auch in Afrika sorgt die hartnäckige Pilzkrankheit regelmässig für massive Ernteausfälle.

Gentechnik im Schweizer Alltag - «Überall häts Genli drin!»
Das seit 2005 bestehende Gentechnik-Moratorium vermittelt den Eindruck, dass die Schweiz weitgehend frei von Gentechnik ist. Doch ein genauerer Blick zeigt: Die Gentechnik hat längst ihren festen Platz in unserem Alltag – nur bemerken wir es meistens nicht.

Globale Fakten zu Welternährung und Landwirtschaft
Nur dank technologischem Fortschritt und modernem Pflanzenschutz werden wir in Zukunft unsere Ressourcen schonen und gleichzeitig immer mehr Menschen gesund und erschwinglich ernähren können.

Pestizide in grünen Smoothies
Nach den zahlreichen Rezepten für Weihnachtsplätzchen, Festtagsbraten und Cocktails sind jetzt die Tipps fürs Abnehmen, Entschlacken und Verschönern gesetzt. Das meiste ist blanker Unsinn. Das schreibt Gastautor und Wissenschaftsjournalist Ludger Wess in seinem Artikel.

Natürliche Gifte: Unterschätzte Gefahr in unserer Nahrung
Sichere Lebensmittel sind keine Selbstverständlichkeit. Während oft chemische Stoffe in der Kritik stehen, zeigt die Realität: Die grössten Risiken für unsere Lebensmittelsicherheit sind natürlichen Ursprungs. Rückrufe bei Babynahrung zeigen, wie tückisch Bakteriengifte oder Schimmelpilze sind.

