
Wie NZT beliebte Sorten widerstandsfähiger machen
Neue Züchtungstechnologien (NZT) bieten Lösungen – doch in der aktuellen Debatte werden sie schlicht ignoriert. Wer über den fehlenden Geschmack von Erdbeeren klagt, muss auch bereit sein, moderne Methoden wie die Genom-Editierung zuzulassen.
Dienstag, 13. Mai 2025
An einem warmen Frühlingstag in eine saftige Erdbeere zu beissen – wer liebt das nicht? Zwischen Mai und September ist Saison für die roten Früchte. Besonders gefragt sind regionale Erdbeeren. Doch ausgerechnet beim Aroma enttäuschen viele Sorten. Was einst selbstverständlich war – der Duft und Geschmack einer echten Erdbeere –, ist selten geworden. Doch das Bedürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten nach geschmackvollen Früchten ist unverändert gross.
Dem Thema hat sich nun auch die «NZZ» angenommen. Die «NZZ» spricht in einem aktuellen Artikel gar von «roten Wasserbomben». Schuld sei die jahrzehntelange Züchtung auf Ertrag, Haltbarkeit und Transportfähigkeit. Der Geschmack blieb dabei auf der Strecke.
Auch ETH-Biotechnologe Wilhelm Gruissem bestätigt im Interview mit der «Aargauer Zeitung» diesen Trend: «Viele Früchte – besonders Beeren wie Erdbeeren, Himbeeren oder Heidelbeeren – haben nicht mehr den Geschmack, den ich aus meiner Kindheit kenne.» Laut Gruissem sind Ertrag, Haltbarkeit und Aroma genetisch oft eng miteinander gekoppelt. Geht eines verloren, bleibt der Geschmack auf der Strecke. Bei der Erdbeere seien rund 30 Prozent der genetischen Vielfalt verloren gegangen.
Trotzdem scheinen die roten Früchte nach wie vor Abnehmer zu finden: In der Schweiz werden jährlich 7000 Tonnen Erdbeeren geerntet, dazu kommen 16’000 Tonnen Importe, vor allem aus Spanien. Die Nachfrage ist ungebrochen – die Qualität allerdings oft enttäuschend.
Dabei spielt nicht nur die Genetik eine Rolle, sondern auch das Wetter und der Erntezeitpunkt. Wie Chantale Meyer vom Schweizer Obstverband gegenüber der «Aargauer Zeitung» erklärt, können ein zu nasser Frühling oder eine zu frühe Ernte das Aroma zusätzlich beeinträchtigen. Der Vorteil inländischer Früchte: Sie können vollreif geerntet werden – ein klarer Pluspunkt gegenüber Importware, die oft unreif gepflückt wird.
Mieze Schindler – das aromatische Erbe
Doch es gibt sie noch, die Erdbeere mit Geschmack mit dem eigentümlichen Namen: Mieze Schindler. Kenner schwören auf die Sorte. Es sei die letzte Erdbeere, die noch nach Erdbeere schmeckt.
Vor über 100 Jahren wurde sie vom Gartenbaulehrer Otto Schindler gezüchtet – benannt nach dem Kosenamen seiner Frau. Mieze schmeckt wie eine Walderdbeere, nur süsser. Das verdankt sie dem Aromastoff Methylanthranilat, der in modernen Sorten fast vollständig verschwunden ist.
Ihr Nachteil: Sie ist äusserst empfindlich – schlecht lagerfähig, kaum transportierbar, anfällig gegenüber Pilzkrankheiten und Nässe. Im Handel hat sie keine Chance. Wer sie geniessen will, muss sie selbst anbauen.
Der blinde Fleck der «NZZ»: Genom-Editierung
So weit, so richtig – doch was der «NZZ»-Artikel mit keinem Wort erwähnt, ist die naheliegende Lösung: Genom-Editierung. Dass ein Beitrag über das Dilemma der modernen Erdbeerzucht diese Technologie komplett ausblendet, ist nicht nachvollziehbar. Gerade weil die Genom-Editierung bereits angewendet wird – und genau dort ansetzt, wo das Problem liegt. Immerhin wird die Genschere Crispr/Cas in der «AZ» kurz erwähnt. So habe man bei der Tomate mit der Genschere schon einiges erreicht, wie Crispr-Experte Gruissem erklärt: «Bei der Erdbeere ist die Hauptkomponente für den Aromageschmack das Methylanthranilat, das häufig auch für Parfüms verwendet wird.»
Auch das niederländische Unternehmen Hudson River Biotechnology (HRB) hat kürzlich verkündet, erstmals Erdbeeren aus genomeditierten Einzelzellen gezüchtet zu haben. Möglich macht das die hauseigene TiGER-Technologie. Dank CRISPR kann gezielt auf Eigenschaften wie Aroma, Widerstandsfähigkeit und Ertrag Einfluss genommen werden – ohne fremde DNA einzufügen.
Gerade bei einer genetisch komplexen Pflanze wie der Erdbeere (sie besitzt acht Chromosomensätze) ist das ein Durchbruch. Traditionelle Züchtung ist hier viel zu langsam und ungenau.
Die Industrie arbeitet längst an entsprechenden Lösungen. So treibt der Life-Science-Konzern Bayer die Präzisionszucht im Obst- und Gemüsesektor voran. JD Rossouw, Forschungsleiter bei Bayer Crop Science, erklärt: «Wir haben im Bereich der Präzisionszucht bereits eine starke Basis aufgebaut und freuen uns darauf, unsere Ansätze nun auch bei Erdbeeren anzuwenden.»
Gerade im Fall der Sorte Mieze Schindler wäre eine solche Weiterentwicklung besonders sinnvoll. Denn ihr Geschmack ist einzigartig und unerreicht. Es braucht also nicht zwingend die Entwicklung völlig neuer Sorten – vielmehr sollte das Ziel darin bestehen, bewährte Sorten wie Mieze Schindler gezielt zu verbessern: etwa indem man sie widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Nässe macht. Genau das ermöglicht die Genom-Editierung – ohne den unverwechselbaren Geschmack zu verändern. Folgendes Zitat von Rebbaukommissär Jürg Maurer bringt es auf den Punkt: «Ein Merlot oder Chasselas ohne Pilzkrankheiten wäre für mich besser als eine neue (Piwi-)Sorte.»
Technologien zulassen statt über mangelnden Geschmack jammern
Neue Züchtungstechnologien sind der Schlüssel für nachhaltige Landwirtschaft. Mit ihr lässt sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren, der Ertrag steigern und die Umwelt schonen – ohne auf Geschmack zu verzichten. In einer Welt mit wachsender Bevölkerung und knapper werdenden Ressourcen brauchen wir genau solche Lösungen.
Statt weiterhin zu klagen, dass Erdbeeren nicht mehr schmecken, sollten wir die neue Züchtungstechnologien endlich zulassen. Das Vereinigte Königreich hat den Weg bereits geebnet und ein Gesetz verabschiedet, das den Anbau von genomeditierten Pflanzen erleichtert. Es wird Zeit, dass die Politik auch hierzulande vorwärtsmacht. So ist die beliebte Mieze Schindler hoffentlich eines Tages auch im Handel erhältlich, zur Freude der einheimischen Gaumen.
Ähnliche Artikel

Vereinigtes Königreich ebnet Weg für den Anbau genom-editierter Pflanzen
Das britische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das den Anbau von genomeditierten Pflanzen erleichtert.
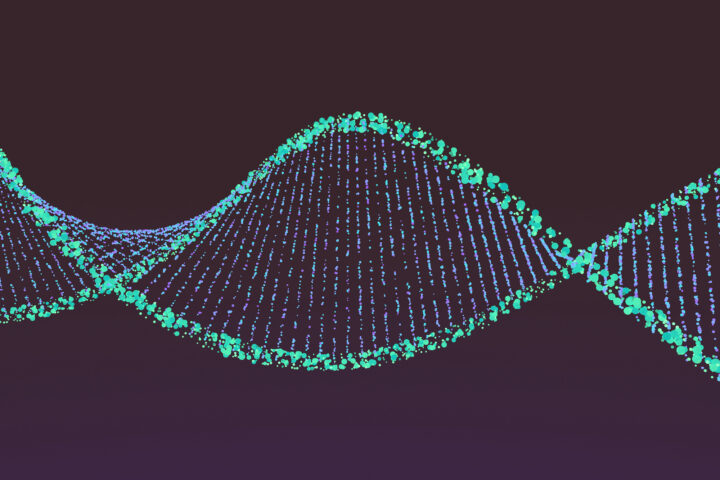
Argumente für neue Züchtungstechnologien
Pflanzenzucht ist komplex. Entsprechend viele Fragen gibt es in der Diskussion rund um neue Züchtungsmethoden. swiss-food.ch hat die wichtigsten Fragen und Antworten zu neuen Züchtungstechnologien zusammengestellt.

Neue Züchtungsmethoden – gekommen, um zu bleiben
Das Schweizer Parlament hat eine Aktualisierung des seit 2005 bestehenden Gentech-Moratoriums beschlossen. Der Schritt war überfällig. Anlässlich eines von swiss-food.ch organisierten Talks sprachen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Landwirtschaft über den Nutzen neuer biotechnologischer Züchtungsmethoden. Dabei wurde klar: die Risiken sind gering, die Chancen gross.

Was wirklich im Einkaufskorb steckt
Gentechnik im Einkaufskorb? Ja – und viel häufiger, als wir denken. Ob Pasta, Brot oder Gemüse: Viele unserer Alltagsprodukte stammen aus Mutationszüchtungen, die ein Eingriff ins Genom sind und als sicher gelten. Höchste Zeit, mit gängigen Mythen aufzuräumen.

Die genomischen Züchtungsmethoden bekommen keine Chance, sich zu beweisen
Moderne genomische Züchtungsmethoden gelten rechtlich als Gentechnik – und sind deshalb bis heute faktisch blockiert. Dabei essen wir seit Jahrzehnten gentechnisch veränderte Pflanzen, nur unter dem Etikett «klassische Mutagenese». Die neuen, präziseren Verfahren werden strenger reguliert als die alten, obwohl sie wissenschaftlich als sicherer gelten. Ein Widerspruch, der dringend korrigiert werden müsste. Die EU geht mit gutem Beispiel voran..

Keine Schweinerei: Warum hodenlose Eber ein klares Plus fürs Tierwohl sind
Neue Züchtungsmethoden eröffnen neue Möglichkeiten in der Pflanzen- und Tierzucht. Sie erlauben gezielte Veränderungen im Erbgut, die auch Tiere widerstandsfähiger, anpassungsfähiger und gesünder machen können.

Stillstand statt Fortschritt: Die Schweiz droht bei neuen Züchtungen zurückzufallen
Ein Überblicksartikel im Schweizer Bauer zeigt, wie stark die neuen Züchtungsmethoden die bäuerlichen Kreise beschäftigen. Nach Abschluss der Vernehmlassung zum Bundesgesetz wird eine Vorlage erwartet – dann zeigt sich, ob der politische Wille zur Zulassung tatsächlich besteht.

