
Als hätte man hierzulande alle Zeit der Welt
Die EU steckt bei der Regulierung neuer Züchtungstechnologien seit Jahren fest. Auch die Schweiz verschläft die Entwicklung. Während weltweit innovative Ansätze längst kommerziell genutzt werden, fehlt es in Europa und der Schweiz an klaren Regeln – mit weitreichenden Folgen für die hiesigen Landwirte, Züchter und Saatgutvermehrer und den globalen Handel.
Mittwoch, 29. Januar 2025
Die EU hat es nicht eilig mit der Regulierung der neuen Züchtungstechnologien. Seit Jahren diskutiert man, wie man mit diesen innovativen Ansätzen in der Europäischen Union umgehen soll. Und bis heute scheint darüber keine mehrheitsfähige Lösung gefunden worden zu sein. Dabei liegt eigentlich ein Vorschlag der EU-Kommission vor, der längst umgesetzt sein sollte. Dieser möchte zwei Kategorien von Züchtungen einführen: In die erste sollen Pflanzen fallen, die mit den neuen genomischen Züchtungstechnologien gezüchtet wurden, aber ohne Einbringung fremder DNA entstanden sind. Diese wären von den Auflagen des geltenden Gentechnikrechts ausgenommen und könnten damit sehr schnell zugelassen und frei gehandelt werden. In die zweite Kategorie würden jene Produkte und Pflanzen fallen, welche fremde DNA enthalten. Diese würden innerhalb der Gentechnikgesetzgebung abgehandelt.
Auch die Schweiz bewegt sich im Kriechgang
Bereits im Jahr 2021 hat das Parlament den Bundesrat beauftragt, eine risikobasierte Regelung für die Zulassung von Pflanzen aus neuen Züchtungstechnologien auszuarbeiten. Dies hätte er gemäss Gesetzestext bis im Sommer 2024 machen müssen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf ist nun aber erst fürs Jahr 2026 vorgesehen. Aufgrund dieser Verzögerung hat die Kommission vorgeschlagen, das Ende 2025 auslaufende Gentech-Moratorium um zwei Jahre zu verlängern. Damit soll verhindert werden, dass in Bezug auf die neuen Züchtungstechnologien eine Gesetzeslücke entsteht. Jetzt verschleppt der Bundesrat eine risikobasierte Zulassung sogar noch weiter und will das Gentech-Moratorium unverändert bis ins Jahr 2030 verlängern. Ob das Parlament die bundesrätliche Schneckenpost absegnet, ist zumindest fraglich.
Eine Umsetzung einer risikobasierten Gesetzgebung ist in der Schweiz und der EU in weiter Ferne. Gleichzeitig steigen weltweit die Züchter im grossen Stil bei den neuen Züchtungstechnologien ein. Eine kommerzielle Nutzung gibt es gemäss «Top Agrar» in vielen Ländern bereits heute und das starke Wachstum dieses Bereichs wird weiter anhalten. Die Musik spielt längst anderswo.
Keine Unterscheidung mehr möglich
Und damit steigt auch der Druck, endlich zukunftsgerichtet zu regulieren. So weist beispielsweise die Präsidentin des Verbandes der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid), Jaana Kleinschmit von Lengefeld, in einem Artikel der Plattform «topagrar.com» darauf hin, dass die EU einen jährlichen Importbedarf von rund 30 Millionen Tonnen Soja(schrot) hat, um den eigenen Proteinbedarf zu decken. Dieses Soja käme unter anderem aus Südamerika, wo viele Staaten die neuen Züchtungstechnologien auch im Sojaanbau zugelassen haben. In der Konsequenz sehe die Realität vor Ort so aus: Zahlreiche LKW-Ladungen von unterschiedlichen Produzenten würden zu Schiffstransporten von bis zu 80'000 Tonnen zusammengefasst und global verschifft. Eine Trennung und Nachverfolgung der einzelnen Partien sei da schlicht unmöglich und für europäische Händler im Extremfall ein grosses Problem: Denn unter dem aktuellen Gentechnikrecht bleibt das Gebot der Nulltoleranz bestehen. Im Äussersten wären die Händler gezwungen, solche für die Versorgung des europäischen Marktes wichtigen Destinationen zu blockieren, um nicht selbst schadensersatzpflichtig zu werden.
Das Beispiel zeigt: Die Welt der Pflanzenzüchtung dreht sich rasant weiter. Innovative Methoden haben sich längst durchgesetzt. Nur in den Kommissionszimmern und Ratssälen Europas scheint man die Zeichen der Zeit nicht erkannt zu haben, zum Nachteil der hiesigen Landwirte, Konsumenten, Züchter und Saatgutvermehrer.
Die Musik spielt bei der Pflanzenzucht längst anderswo
Die Innovation wartet nicht auf die Bedenkenträger in Europa und der Schweiz. Die innovativen Züchtungen geschehen vermehrt andernorts. Führend sind dabei die grossen Landwirtschaftsmärkte wie die USA, Brasilien oder auch China. In China wurde im Mai 2024 ein genomeditierter Weizen zum Anbau zugelassen. Der Weizen ist krankheitsresistenter und verspricht höhere Erträge. Insgesamt ist China führend in der Entwicklung genomeditierter Nutzpflanzen: 509 der Ende Mai 2024 weltweit bekannten 900 Züchtungsprojekte dazu stammten aus dem Reich der Mitte, berichtet der Point-Newsletter von scienceindustries. Und führt weiter aus: «Unter den wichtigen Züchtungszielen befinden sich gesteigerte Erträge, Krankheitsresistenz, Stresstoleranz und eine verbesserte Nahrungs- und Futtermittelqualität.»
Sources
Ähnliche Artikel
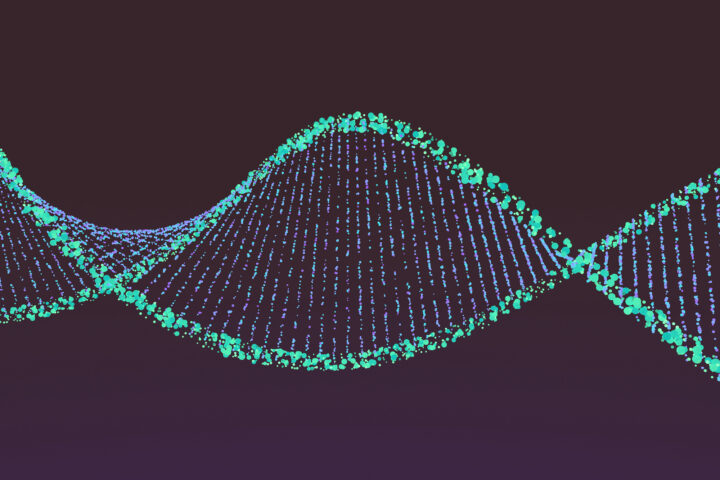
Argumente für neue Züchtungstechnologien
Pflanzenzucht ist komplex. Entsprechend viele Fragen gibt es in der Diskussion rund um neue Züchtungsmethoden. swiss-food.ch hat die wichtigsten Fragen und Antworten zu neuen Züchtungstechnologien zusammengestellt.

Bundesrat und die neuen Züchtungstechnologien: Zu wenig und zu spät
Es ist enttäuschend, was der Bundesrat am 25. Oktober 2023 zum Thema neue genetische Verfahren in einer Medienmitteilung verlauten liess. Sowohl inhaltlich als auch zeitlich steht die Regierung auf der Bremse. Das Zaudern ist unverständlich.

Zehn Anwendungen neuer Züchtungstechnologien für die Schweiz
Der Sommer 2021 hat gezeigt, wie schädlich anhaltender Regen für Kulturpflanzen sein kann. Mit dem Klimawandel wird die Wahrscheinlichkeit für extreme Wetterereignisse noch zunehmen. Deshalb benötigen Landwirte verbesserte Pflanzensorten, die Hitze, aber auch viel Nässe aushalten.

Was wirklich im Einkaufskorb steckt
Gentechnik im Einkaufskorb? Ja – und viel häufiger, als wir denken. Ob Pasta, Brot oder Gemüse: Viele unserer Alltagsprodukte stammen aus Mutationszüchtungen, die ein Eingriff ins Genom sind und als sicher gelten. Höchste Zeit, mit gängigen Mythen aufzuräumen.

Die genomischen Züchtungsmethoden bekommen keine Chance, sich zu beweisen
Moderne genomische Züchtungsmethoden gelten rechtlich als Gentechnik – und sind deshalb bis heute faktisch blockiert. Dabei essen wir seit Jahrzehnten gentechnisch veränderte Pflanzen, nur unter dem Etikett «klassische Mutagenese». Die neuen, präziseren Verfahren werden strenger reguliert als die alten, obwohl sie wissenschaftlich als sicherer gelten. Ein Widerspruch, der dringend korrigiert werden müsste. Die EU geht mit gutem Beispiel voran..

Keine Schweinerei: Warum hodenlose Eber ein klares Plus fürs Tierwohl sind
Neue Züchtungsmethoden eröffnen neue Möglichkeiten in der Pflanzen- und Tierzucht. Sie erlauben gezielte Veränderungen im Erbgut, die auch Tiere widerstandsfähiger, anpassungsfähiger und gesünder machen können.

Stillstand statt Fortschritt: Die Schweiz droht bei neuen Züchtungen zurückzufallen
Ein Überblicksartikel im Schweizer Bauer zeigt, wie stark die neuen Züchtungsmethoden die bäuerlichen Kreise beschäftigen. Nach Abschluss der Vernehmlassung zum Bundesgesetz wird eine Vorlage erwartet – dann zeigt sich, ob der politische Wille zur Zulassung tatsächlich besteht.

